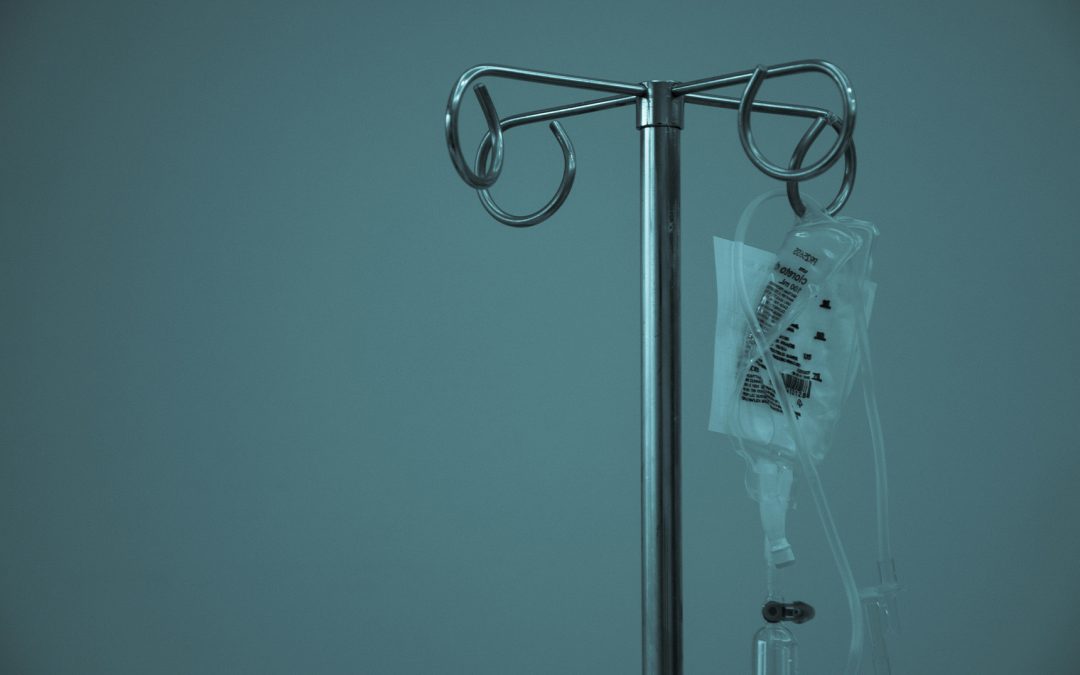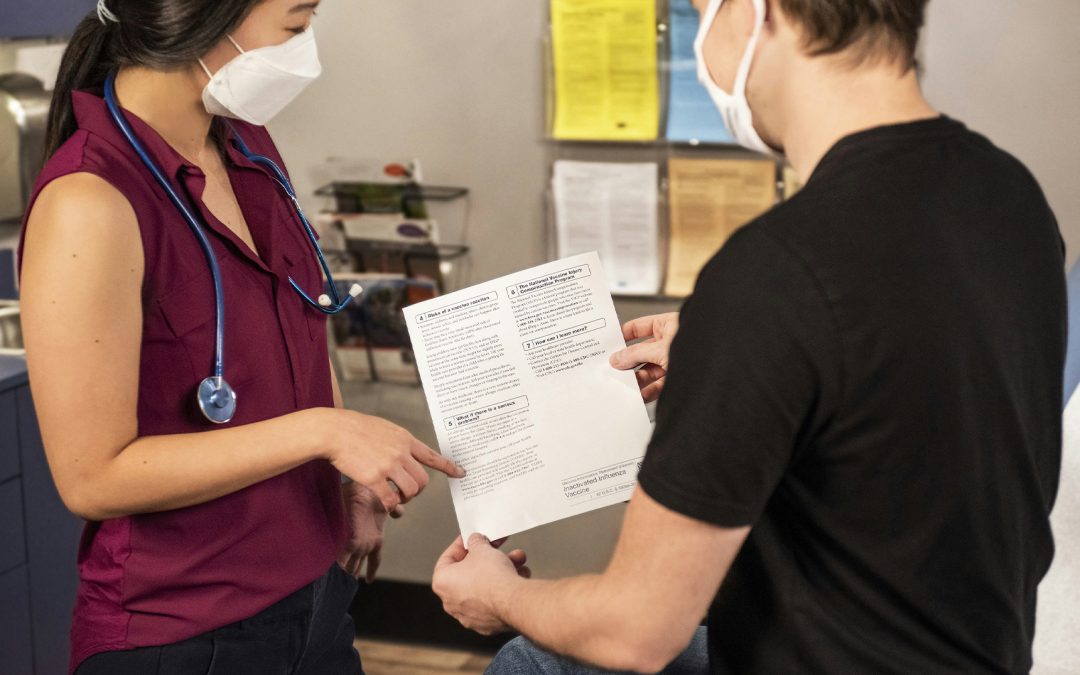by Marcus Vogeler | 13.02.2024
Der BGH hatte sich mit der Frage der ärztlichen Aufklärung über Operationserweiterungen zu befassen. Vor chirurgischen Eingriffen – so der Arzthaftungssenat – muss der Patient vor chirurgischen Eingriffen, bei denen der Arzt die ernsthafte Möglichkeit einer Operationserweiterung oder den Wechsel in eine andere Operationsmethode in Betracht ziehen muss, hierüber und über die damit ggf. verbundenen besonderen Risiken aufgeklärt werden. Hat der Arzt vor der Operation Hinweise auf eine möglicherweise erforderlich werdende Operationserweiterung unterlassen und zeigt sich intraoperativ die Notwendigkeit einer Erweiterung, dann muss er, soweit dies möglich ist, die Operation beenden, den Patienten nach Abklingen der Narkoseeinwirkungen entsprechend aufklären und seine Einwilligung in den weitergehenden Eingriff einholen.
Rechtlich stellt sich die Frage, inwieweit Raum für die Annahme einer mutmaßlichen Einwilligung ist. Viel Raum hierfür das der Gesetzgeber nicht gelassen. In § 630d Abs. 1 S. 4 BGB heißt es: „Kann eine Einwilligung für eine unaufschiebbare Maßnahme nicht rechtzeitig eingeholt werden, darf sie ohne Einwilligung durchgeführt werden, wenn sie dem mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht.“ Kurzum: Nach dem Wortlaut besteht nur bei unaufschiebbaren Maßnahmen die Möglichkeit für die Annahme einer mutmaßlichen Einwilligung. Ob darüber hinaus – wie in der Literatur teilweise vertreten wird – eine mutmaßliche Einwilligung in Betracht kommt, ist noch ungeklärt und wurde auch durch den BGH noch nicht ausdrücklich entschieden.
BGH, Beschluss vom 14.11.2023 – VI ZR 380/22

by Marcus Vogeler | 13.02.2024
In einer Grundsatzentscheidung hat der BGH zu der Frage Stellung genommen, ob dem Patienten vor der Erteilung der Einwilligungserklärung eine Bedenkzeit einzuräumen ist. Dies wurde durch den VI. Senat verneint: Nach st. Rspr. ist der Patient vor dem beabsichtigten Eingriff so rechtzeitig aufzuklären, dass er durch hinreichende Abwägung der für und gegen den Eingriff sprechenden Gründe seine Entscheidungsfreiheit und damit sein Selbstbestimmungsrecht in angemessener Weise wahrnehmen kann. Die Bestimmung des § 630e Abs. 2 Nr. 2 BGB sieht keine vor der Einwilligung einzuhaltende „Sperrfrist“ vor, deren Nichteinhaltung zur Unwirksamkeit der Einwilligung führen würde; sie enthält kein Erfordernis, wonach zwischen Aufklärung und Einwilligung ein bestimmter Zeitraum liegen müsste. Zu welchem konkreten Zeitpunkt ein Patient nach ordnungsgemäßer – insbesondere rechtzeitiger – Aufklärung seine Entscheidung über die Erteilung oder Versagung seiner Einwilligung trifft, ist seine Sache. Sieht er sich bereits nach dem Aufklärungsgespräch zu einer wohlüberlegten Entscheidung in der Lage, ist es sein gutes Recht, die Einwilligung sofort zu erteilen. Wünscht er dagegen noch eine Bedenkzeit, so kann von ihm grundsätzlich erwartet werden, dass er dies gegenüber dem Arzt zum Ausdruck bringt und von der Erteilung einer – etwa im Anschluss an das Gespräch erbetenen – Einwilligung zunächst absieht. Eine andere Beurteilung ist – sofern medizinisch vertretbar – allerdings dann geboten, wenn für den Arzt erkennbare konkrete Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass der Patient noch Zeit für seine Entscheidung benötigt.
BGH, Urteil vom 20.12.2022 – VI ZR 375/21

by Marie von Hirschheydt | 13.02.2024
Die Haftung von Telemedizinern – eine Besonderheit, die insb. in der letzten Zeit an Bedeutung gewonnen haben dürfte. Hintergrund war die Frage, ob ein Krankenhaus bei Hinzuziehung eines Telemediziners auch für dessen Fehler haftet. Vorausgegangen war ein medizinisches Konsil im Rahmen einer Schlaganfalldiagnostik, bei der ein Telemediziner hinzugezogen worden war. Zunächst wurde dem Klinikum eine verspätete Diagnostik vorgeworfen, die irreversible Gesundheitsschäden beim Patienten zur Folge hatte. Das Klinikum verwies auf das telemedizinische Netzwerk und sah dieses in der rechtlichen Verantwortung. Das Gericht folgte dieser Ansicht jedoch nicht, sondern sah die Haftung beim Krankenhaus, da dieses „so oder so“ hafte. Auf die Entscheidung, durch wen die Verzögerung hervorgerufen worden sei – Klinikum oder Telemediziner – komme es somit nicht an.
LG München II vom 10.5.2022 – 1 O 4395/20
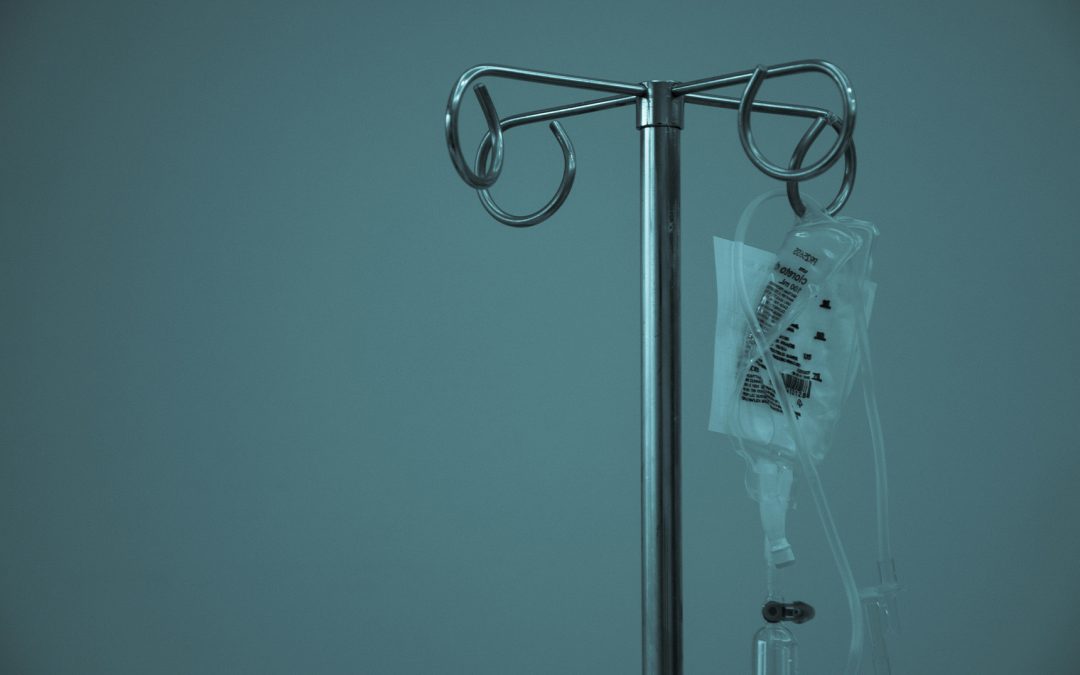
by Marie von Hirschheydt | 13.02.2024
Aufsehen erregte ein Urteil des LG Limburg vom 28.6.2021 (1 O 45/15), in dem einem zum Zeitpunkt des Schadensereignisses zwei Jahre alten Kläger ein Schmerzensgeldbetrag in Höhe von 1 Mio. Euro zuerkannt wurde. Mit Urteil vom 25.04.2023 (Az.: 8 U 127/21) wurde durch das OLG Frankfurt am Main das Urteil aufgehoben und entschieden, dass ein Anspruch auf Schadensersatz nach einer intravenösen Antibiotikagabe, in dessen Folge es zu einer Aspiration und bleibenden schweren Hirnschäden kam, nicht besteht.
Das zum Zeitpunkt der Behandlung 14 Monate alte Kleinkind war aufgrund einer obstruktiven Bronchitis und drohenden respiratorischen Insuffizienz in stationärer Behandlung gewesen. Nachdem die Kinderkrankenschwester intravenös ein Antibiotikum gegeben hatte, fing das Kind an zu schreien und wurde bewusstlos, da ein Apfelstück in die Luftröhre gelangt war. Infolge der Aspiration kam es zu einem hypoxischem Hirnschaden. Das Verhalten der Kinderkrankenschwester wurde durch das Gericht als nicht behandlungsfehlerhaft beurteilt. Auch auf dem Tisch liegende Apfelstückchen und Kartoffelchips in den Händen des Kleinkindes führen demnach nicht zu weitergehenden Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer intravenösen Antibiotikagabe. Zu berücksichtigen seien hierbei lediglich die allgemein der Verminderung des Aspirationsrisikos zu beachtenden Vorsichtsmaßnahmen. Die Gefahr der Aspiration besteht bei Kleinkindern in nahezu jeder alltäglicher Lebenslage, sodass sich hieraus keine gesteigerten Vorsichtsmaßnahmen ergeben würden.
OLG Frankfurt a. M. Urt. v. 25.4.2023 – 8 U 127/21
Anhängig: BGH – VI ZR 163/23
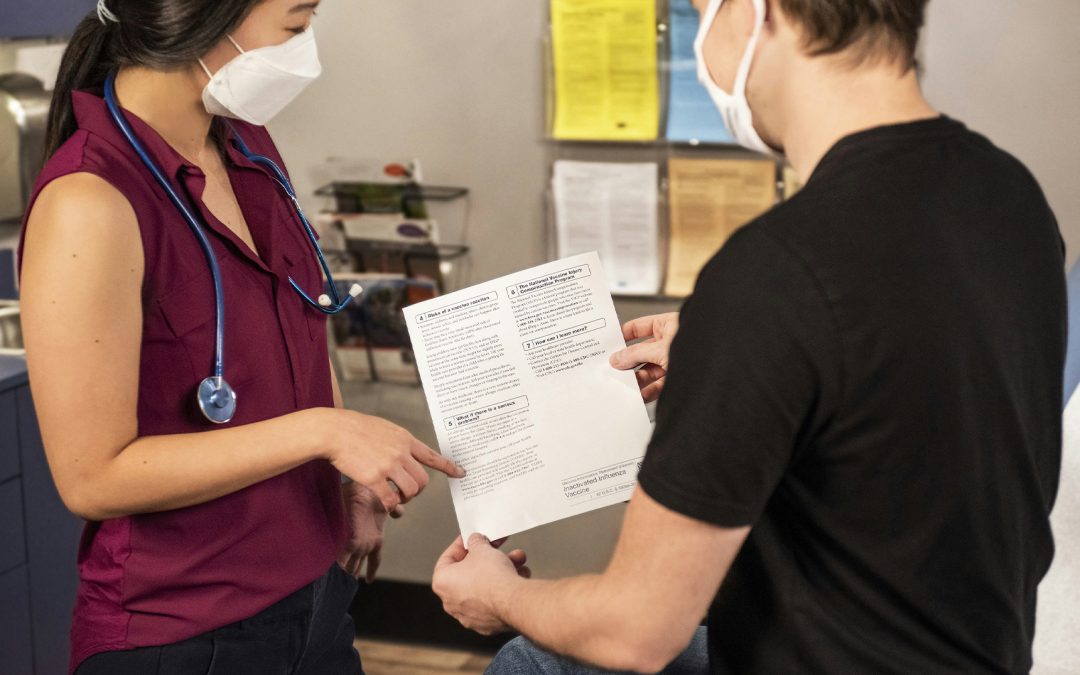
by Marcus Vogeler | 13.02.2024
Parallel zu den Klagen gegen Impfstoffhersteller begannen auch die Prozesse gegen Ärzte aufgrund durchgeführter Coronaimpfungen. Im Fokus stehen in diesen Prozessen zwei Fragen:
- Umfang der Aufklärung und Erforderlichkeit eines mündlichen Gesprächs
- Persönliche Haftung des Impfenden oder Eingreifen der Amtshaftung
Das LG Heilbronn (Urt. v. 14.2.2023 – Wo 1 O 65/22) hielt eine mündliche Aufklärung nicht für erforderlich. Bei der streitgegenständlichen Impfung wurde – so das LG Heilbronn – ein neuartiger mRNA-Impfstoff verabreicht. Aus diesem Grunde handele es sich nicht um eine Routineimpfung im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung. Gleichwohl sei nach Auffassung der Kammer die Grundsätze des BGH zu den sogenannten Routineimpfungen auf den vorliegenden Fall zu übertragen. Würde man nämlich verlangen, dass vor jeder Impfung ein persönliches ausführliches ärztliches Aufklärungsgespräch erforderlich ist, wäre dies logistisch kaum zu leisten gewesen und hätte die Impfkampagne erheblich verzögert. Die Rspr. ist höchstrichterlich noch nicht bestätigt worden und steht mit der Vorschrift des § 630e Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht im Einklang.
Das LG Dortmund (Urt. v. 1.6.2023 – 4 O 163/22) hat entschieden, dass niedergelassene Ärzte für Schäden aus einer Corona-Schutzimpfung nicht persönlich haften. Solche Ansprüche seien nach Art. 34 Satz 1 GG ausgeschlossen, da Ärzte bei der Corona-Schutzimpfung in Ausübung der ihnen insoweit übertragenen hoheitlichen Aufgaben als Beamte im haftungsrechtlichen Sinne handelten.